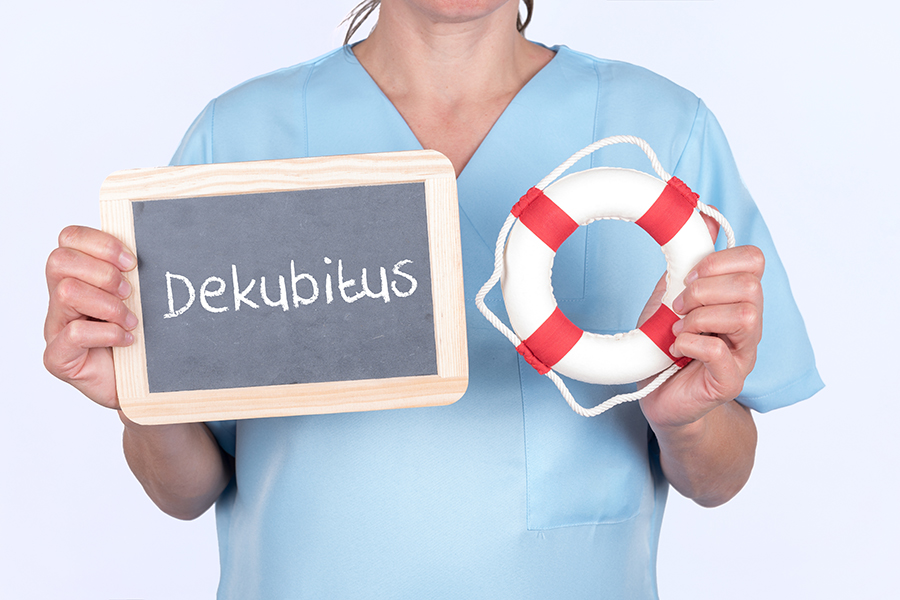Ernährung als ein Schlüsselfaktor bei Dekubitus: Hintergründe und Praxistipps für Pflegekräfte
Die Ernährung spielt eine wesentliche Rolle bei der Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie. Eine wichtige Pflegeaufgabe ist es daher, eine Mangelernährung rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Dabei können diese Praxistipps unterstützen.1,2
Pflegerische Versorgung bei Dekubitus: Ernährung gezielt mitdenken
Vermutlich denkt man nicht sofort an das Thema Ernährung, wenn es um die pflegerische Versorgung von chronischen Wunden wie einem Dekubitus geht. Dabei ist die ausreichende Versorgung mit Mineral- und Nährstoffen ein entscheidender Faktor für die Wundheilung sowie die Prophylaxe. Pflegekräfte sollten deshalb die Ernährungssituation im Blick behalten und rechtzeitig handeln, wenn Anzeichen einer drohenden Mangelernährung erkennbar sind.1
Was gehört zu einer ausgewogenen Ernährung bei Dekubitus?
Als Orientierung für Menschen mit Dekubitus gelten grundsätzlich die Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Maßgeblich ist dabei der Ernährungskreis, den die DGE im Jahr 2024 vorgestellt hat. Er gilt für gesunde Erwachsene im Alter von 18 bis 65 Jahren, die pflanzliche und tierische Lebensmittel essen. Demnach setzt sich eine gesunde und umweltschonende Ernährung zusammen aus:3
- Drei Viertel pflanzliche Lebensmitteln: Dazu gehören „Obst und Gemüse“, „Hülsenfrüchte und Nüsse“ sowie „Getreide, Getreideprodukte und Kartoffeln“. Sie sorgen für eine ausreichende Zufuhr von Kohlenhydraten, Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen.
- Ein Viertel tierische Lebensmittel: Kleine Portionen aus den Lebensmittelgruppen „Milch und Milchprodukte“ sowie „Fleisch, Wurst, Fisch und Eier“ ergänzen den Speiseplan.
- Kein Alkohol: Es existiert keine Menge an Alkohol, die für die Gesundheit unbedenklich ist.
Sonderfall Eiweiß: Die Empfehlungen aus dem DGE-Ernährungskreis gelten für gesunde Erwachsene bis 65 Jahren.3 Allerdings verändert sich im höheren Lebensalter und bei Menschen mit chronischen Wunden wie einem Dekubitus der Energie- und Nährstoffbedarf – insbesondere mit Blick auf die Eiweißmenge.1,4 Abhängig von der Wunde und deren Exsudation kann der Eiweißbedarf von 0,8 g/kg Körpergewicht (Gesunde) auf 1,0 bis 1,5 g/kg Körpergewicht steigen. Denn der Körper braucht das Eiweiß für die Wundheilung. Zudem können manche Patientinnen und Patienten täglich bis zu 50 g Eiweiß über die Wunde verlieren.1
Was bringt eine „antientzündliche Ernährung“ bei Dekubitus?
Mit einer antientzündlichen (antiinflammatorischen) Ernährungsweise sollen chronische Entzündungsvorgänge im Körper – auf die viele Erkrankungen zurückgehen – eingedämmt oder verhindert werden. Dazu gehören Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes mellitus oder Krebs.5Auch in chronischen Wunden wie Dekubitus finden Entzündungsvorgänge statt. Daher kann eine antientzündliche Ernährung die Wundheilung günstig beeinflussen.1 Dabei werden Lebensmittel mit potenziell entzündungshemmenden Eigenschaften konsumiert. Beispiele sind fetter Fisch (Lachs, Makrele), Beeren, Spinat, Kohl, Vollkornmehl (zum Beispiel von Gerste und Hafer), ungeschälter Reis, Leinsamen, Olivenöl, Avocados, Mandeln, Cashewkerne und Hülsenfrüchte. Sie enthalten Substanzen, die Entzündungsvorgängen entgegenwirken können. Zu diesen Inhaltsstoffen gehören unter anderem:.5
- Ballaststoffe
- Vitamin C
- Vitamin E
- Omega-3-Fettsäuren
- Zink
- Polyphenole
Dagegen wird der Konsum entzündungsfördernder Nahrungsmittel eingeschränkt. Dazu zählen rotes und verarbeitetes Fleisch, raffinierte (verarbeitete) Kohlenhydrate und gesättigte Fettsäuren.5
Hauptartikel: Dekubitus
- Dekubitus-Assessment
- Dekubitus: Grade, Stadien, Klassifikation
- Ernährung bei Dekubitus
- Expertenstandard Dekubitus
- Fallbeispiele Dekubitus, Behandlungs- und Heilungsverläufe mit Bildern
- Fersendekubitus
- Dekubitus-Therapie mit Lappenplastik
- Dekubitusprophylaxe: Positionierung und Hilfsmittel
- Sakraldekubitus
- Stuhlmanagement bei Sakraldekubitus
- Wundauflagen zur Dekubitus-Wundversorgung
Dekubitus: Fortbildung mit DRACO Wunde+
Wie Ernährung und Dekubitus physiologisch zusammenhängen
Bei bestehenden chronischen Wunden wie einem Dekubitus ist die ausreichende Versorgung mit Nährstoffen eine Voraussetzung für die Wundheilung. Maßgeblich sind dabei Nährstoffe, die zur Zellteilung und zum Aufbau von Kollagengewebe beitragen. Neben Eiweiß gehören dazu auch verschiedene Mikronährstoffe (Tab. 1) – insbesondere Vitamin A, B-Vitamine, Vitamin C, Zink, Eisen und Selen.1
Tab. 1: Essenzielle Mikronährstoffe für die Wundheilung:
| Mikronährstoff | Ist erforderlich für… | Enthalten in… |
|---|---|---|
| Vitamin A | Hautaufbau, Zellentwicklung, Immunsystem | Leber, Beta-Carotin-reiches Gemüse wie Möhren |
| Vitamin B6 | Immunsystem | Geflügel, Schweinefleisch, Fisch, Linsen |
| Vitamin B12 | Zellentwicklung/-teilung | Leber, Fisch, Fleisch, Eier |
| Vitamin C | Kollagensynthese, Immunsystem, Eisenaufnahme | Gemüse, Obst, Kartoffeln |
| Eisen | Sauerstoff-Transport im Blut (Hämoglobin), Kollagensynthese | Fleisch, Wurst |
| Selen | Immunsystem | Fleisch, Eier, Fisch, Linsen |
| Zink | Wundverschluss, Immunsystem | Milchprodukte, Fleisch, Geflügel, Eier |
Ein weiterer wichtiger Nährstoff aus Sicht der Wundheilung ist die Aminosäure Arginin, die über verschiedene Mechanismen die Wundheilung beeinflusst, darunter:6
- Förderung der Zellteilung
- Ausgangsmaterial für die Kollagensynthese
Außerdem reguliert Arginin das Immunsystem, die Hormonausschüttung und die Funktion der Blutgefäß-Innenwände (Endothel).6 Typische Arginin-Lieferanten sind zum Beispiel Fleisch, Meeresfrüchte, Nüsse oder Hülsenfrüchte wie Soja.7
Wichtig zu wissen: Bei Menschen mit Dekubitus steigt der Energiebedarf (Grundumsatz) im Vergleich zu Gesunden:1
- Bei Dekubitus < 50 cm², abhängig von Tiefe/Taschenbildung: 1,3- bis 1,5-facher Grundumsatz
- Bei Dekubitus > 50 cm², abhängig von Tiefe/Taschenbildung: 1,5- bis 1,9-facher Grundumsatz
Aufschlüsse über den konkreten Nährstoffbedarf der Patientinnen und Patienten mit Dekubitus können die Farbe und Konsistenz des Exsudats geben:8
- Trübes Exsudat kann ein Anzeichen für einen hohen Eiweißverlust (Fibrin) sein.
- Klares, dünnflüssiges Exsudat kann unter anderem auf eine Mangelernährung (fehlende Mikronährstoffe) hinweisen.
Der Beitrag „Wundheilung und Ernährung“ erläutert ausführlich, wie die Nährstoffe die Wundheilungsprozesse beeinflussen.
Wundheilung und ErnährungMangelernährung: Erhöhtes Dekubitus-Risiko und schlechtere Wundheilung
Mangelernährung (Malnutrition, Fehlernährung) bedeutet, dass dem Körper lebenswichtige Nährstoffe nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Gerade im höheren Lebensalter steigt das Risiko für eine Fehlernährung, weil der Energiebedarf sinkt, während der Vitamin- und Mineralstoffbedarf gleich bleibt.1
Eine Mangelernährung kann einerseits erhebliche Folgen für Menschen mit bestehendem Dekubitus haben, zum Beispiel:1
- Wundheilungsstörungen
- Beeinträchtigung der Immunabwehr/Anfälligkeit für Infektionen
- Verminderte mechanische Stabilität der Dekubitus-Wunde
- Müdigkeit und Antriebsarmut
Andererseits kann eine Mangelernährung über verschiedene Mechanismen das Risiko für die Entwicklung eines Dekubitus erhöhen:1
- Durch den Gewichtsverlust und das reduzierte subkutane Fettgewebe können Knochen hervortreten und es sinkt die Widerstandsfähigkeit der Haut. Sie wird zunehmend druckempfindlich und damit steigt das Risiko für einen Dekubitus.
- Es können sich Eiweißmangelödeme mit einer Minderdurchblutung (Ischämie) des Gewebes entwickeln. Dadurch verschlechtert sich im fraglichen Gewebebereich die Zufuhr von Nährstoffen und der Abtransport von Stoffwechselprodukten, was schließlich zu einer Ulkusbildung führen kann.
- Durch die Antriebsarmut und verringerte Mobilität kann sich Druck in bestimmten Gewebebereichen aufbauen, während sich dort die Durchblutung und Nährstoffversorgung verschlechtern. Schließlich können die Zellen in dem betroffenen Gewebe absterben und es kann sich ein Druckgeschwür (Dekubitus) bilden.
Wichtig zu wissen: Die Ernährungssituation ist eines von sechs Items der Braden-Skala, um das Dekubitus-Risiko bei einer Person einzuschätzen.
Mangelernährung bei Dekubitus rechtzeitig erkennen
Angesichts dieser Zusammenhänge ist es umso wichtiger, dass Pflegefachkräfte einen schlechten Ernährungszustand bei Menschen mit Dekubitus rechtzeitig erkennen und Gegenmaßnahmen ergreifen. Ein erster Anhaltspunkt für eine etwaige Mangelernährung bietet das Ist-Körpergewicht beziehungsweise der entsprechende Body Mass Index (BMI), der folgendermaßen berechnet wird:1
BMI = Ist-Gewicht in kg geteilt durch das Quadrat der Körpergröße in Meter (m²)
Dazu ein Beispiel: Ist-Körpergewicht: 62 kg; Ist-Körpergröße: 1,70 m
BMI = 62 / (1,7)² = 21,5 kg/m²
Der ideale BMI (Soll-Körpergewicht) hängt unter anderem vom Lebensalter ab:1
- 35 bis 44 Jahre: 21 bis 26 kg/m²
- 45 bis 54 Jahre: 22 bis 27 kg/m²
- 55 bis 65 Jahre: 23 bis 28 kg/m²
- Über 65 Jahre: 24 bis 29 kg/m²
Allerdings eignet sich das Körpergewicht nicht als alleiniger Indikator für das Vorliegen einer Mangelernährung, da über-, normal- und untergewichtige Menschen gleichermaßen davon betroffen sein können. Außerdem können Wassereinlagerungen oder Eiweißmangelödeme ein höheres Körpergewicht simulieren und somit über eine Malnutrition hinwegtäuschen.1
Hier können spezielle Screening-Instrumente (klinische Einschätzungstools) dabei unterstützen, Anzeichen für eine Mangelernährung zu identifizieren (Tab. 2).1,9
| Einschätzungstool | Anwendungsbereich |
|---|---|
| Mini Nutritional Assessment (MNA)/Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA-SF) | Geriatrische Patientinnen und Patienten, stationäre Altenpflege |
| Nutritional Risk Screening (NRS) | Stationäre Versorgung |
| Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) | Ambulante Versorgung |
| Pflegerische Erfassung von Mangelernährung und deren Ursachen (PEMU) | Stationäre Langzeit- und Altenpflege |
Tab. 2: Klinische Einschätzungstools für Mangelernährung (Beispiele)
Der PEMU-Fragebogen stützt sich auf die Kriterien zur Risikoerfassung von Mangelernährung, die das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) im Rahmen des aktualisierten „Expertenstandards - Ernährungsmanagement zur Sicherung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege“ erarbeitet hat.1,10
So können Pflegefachkräfte die Ernährung bei Dekubitus unterstützen
Pflegefachkräfte spielen eine zentrale Rolle in Ernährungsfragen und damit bei der Verhinderung von Mangelernährung. Sie …1,9,11
- beobachten die Patientinnen und Patienten
- dokumentieren die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme (Ess- und Trinkprotokolle)
- sprechen etwaige Auffälligkeiten bei den Betroffenen an
- ergreifen Gegenmaßnahmen.1
Da Mangelernährung bei Menschen mit Dekubitus verschiedene Ursachen haben kann, haben Pflegefachkräfte mehrere Ansatzpunkte, um das Ernährungsverhalten zu beeinflussen.1 Ausgangspunkt für alle Maßnahmen ist die Erhebung einer individuellen Ernährungsbiografie. Dabei werden die Vorlieben und Abneigungen für bestimmte Speisen sowie die Bedeutung von Mahlzeiten für die Betroffenen erfasst.9
Die folgende Auswahl an Praxistipps zeigt, wie Pflegefachkräfte die Ernährungssituation von Menschen mit Dekubitus verbessern können.1,9,11
1. Ernährung gezielt ansprechen
Gezielte Fragen können dabei helfen, die konkrete Ernährungssituation zu verstehen und Ansatzpunkte für eine Unterstützung zu finden – zum Beispiel: „Was gab es heute bei Ihnen zum Frühstück?“.1,9,11
2. Selbstständigkeit fördern
Bei Menschen mit Dekubitus kann das selbstständige Essen und Trinken aus verschiedenen Gründen schwierig sein. Hier können Pflegefachkräfte unter anderem mit den folgenden Maßnahmen unterstützen:1,9,11
- Beim Einkauf helfen
- Geschirr und Besteck in Reichweite platzieren
- Verpackungen öffnen
- Spezielle Ess- und Trinkhilfen bereitstellen – wie speziell geformtes Besteck, Tüllenbecher (Schnabelbecher) mit Griffen und Tellerranderhöhungen.
- Trinkgefäße nicht randvoll füllen
- Arme und Hände beim Essen stützen
3. Kau- und Schluckschwierigkeiten vermindern
Bei manchen Patientinnen und Patienten können Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme zur Mangelernährung beitragen. Mögliche Abhilfemaßnahmen sind:1,9,11
- Zahnprothesen mit Haftcreme fixieren oder anpassen lassen (bei Druckstellen)
- Weiche Kost anbieten wie dickflüssige Suppen, Kartoffelbrei, weiches Gemüse (auf Abwechslung achten).
4. Positive Atmosphäre schaffen und Appetit anregen
Eine angenehme Ess-Atmosphäre hilft, den Appetit der Patientinnen und Patienten anzuregen. Dazu gehören:1,9,11
- Gemütlich gedeckter und schön dekorierter Tisch
- Angenehm riechende Speisen anbieten beziehungsweise starke Gerüche vermeiden, wenn die Betroffenen geruchsempfindlich sind
- Speisen appetitlich anrichten (auch pürierte Speisen), auf Abwechslung achten
- Appetitunterstützende Temperatur der Speisen
- Flexible Essenszeiten ermöglichen
- Genug Zeit für das Essen nehmen
- Beim Essen Gesellschaft leisten
5. Mahlzeiten anreichern
In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, die Mahlzeiten anzureichern:1,9
- mit energiereichen Lebensmitteln wie Sahne, Butter oder Speiseöl
- mit Zusatzpräparaten, die Proteine, Vitamine und Mineralstoffe enthalten
Gegebenenfalls können auch Sondermaßnahmen wie Trinknahrung oder eine Sondenernährung erforderlich sein, um eine Mangelernährung zu verhindern.1,9
Wichtig zu wissen: Bei allen Maßnahmen ist es unabdingbar, die Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten zu respektieren. Das heißt, sie bestimmen ihr Ess-Tempo selbst und sie dürfen beim Essen nicht unter Druck gesetzt oder zu etwas gezwungen werden.10
Der „Expertenstandard - Ernährungsmanagement zur Sicherung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege“ enthält weitere Empfehlungen, wie Pflegefachkräfte Mangelernährung erkennen und vermeiden können.9,10
Ernährung und Ernährungsberatung mit DRACO Wunde+
Fazit: Ernährung als wesentlicher Baustein der Dekubitus-Versorgung
Die Ernährung gehört zu den wichtigen Bestandteilen der Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie. Die genannten Beispiele zur Verbesserung der Ernährungssituation bei Dekubitus zeigen, dass oft kleine Maßnahmen ausreichen, eine große Wirkung zu erzielen. So können Pflegefachkräfte entscheidend zur Heilung beitragen, auch wenn sie keine Ernährungsfachleute sind.1,2,9,11