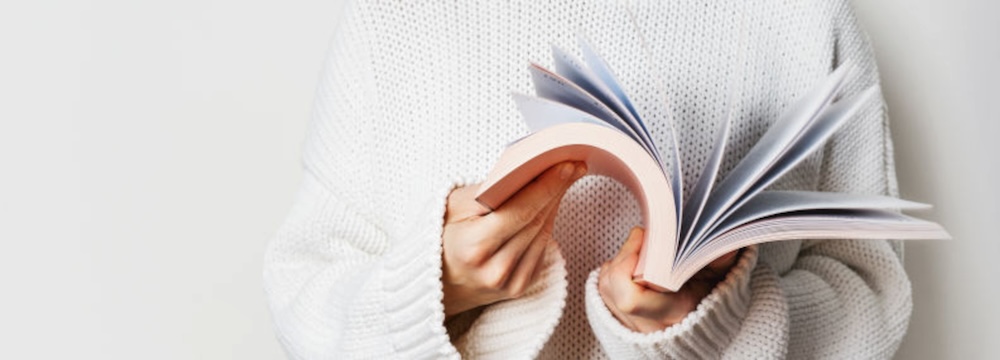Richtgrößen und Richtgrößenprüfung
Die Richtgröße bezeichnet den Euro-Betrag, der für Arznei- und Verbandmittel (inklusive Sprechstundenbedarf) sowie Heilmittelverordnungen pro Patient und Quartal im Durchschnitt zur Verfügung steht.
Dieser Euro-Betrag gilt auch für Patienten, die nur einmal im Quartal zu ihrem Hausarzt oder Facharzt gehen und nichts verschrieben bekommen. Dadurch kann der Arzt anderen Patienten mehr verordnen, als die Richtgröße vorsieht. Entscheidend ist, ob der Arzt seine jährliche Richtgrößensumme einhält (Zahl der Behandlungsfälle x Richtgröße = Richtgrößenvolumen).
Das Richtgrößenvolumen stellt die Grundlage für die gesetzlich vorgeschriebenen Wirtschaftlichkeitsprüfungen dar. Es errechnet sich durch die Multiplikation der Fallzahl mit der dafür jeweils vereinbarten Richtgröße. Wenn ein Vertragsarzt sein Richtgrößenvolumen um mehr als 15 Prozent überschreitet, leitet die zuständige Prüfungsstelle ein Prüfverfahren ein. Hierbei sind bestehende Praxisbesonderheiten relevant, die vom Richtgrößenvolumen ganz oder teilweise abgezogen werden.
Wichtig:
Für Hilfsmittel gibt es keine Richtgrößen.
Richtgrößensumme und Richtgrößenprüfung
Die Einhaltung der Richtgrößensumme wird im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Richtgrößenprüfung jährlich kontrolliert.
Die Prüfung erfolgt durch die von der KV Berlin und den Verbänden der Krankenkassen errichtete Prüfungsstelle. Sie bezieht sich auf die Verordnungstätigkeit des Arztes (Arznei- und Heilmittel).
Die Landesverbände der Krankenkassen und die Kassenärztliche Vereinigungen vereinbaren jährlich, wie viel Geld aus der Gesamtvergütung den Vertragsärzten zur Verordnung von Arzneimittel und Verbandmitteln zur Verfügung gestellt wird.
Die Richtgrößen leiten den Vertragsarzt bei seinen Verordnungen nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot. Um zu berechnen, wie viel ein einzelner Arzt für Arzneimittel und Heilmittel ausgeben darf, werden Durchschnittswerte für die einzelnen Facharztgruppen gebildet. Diese Durchschnittswerte (Richtgrößen) werden dann auf die Arztpraxen aufgeteilt.
Es gibt kein Praxis-Budget für die Wundversorgung selbst. Verbandmittel sind Medizinprodukte und keine Arzneimittel. Sie können zu Lasten der GKV verordnet werden und fallen unter die Richtgrößen (Budget) für Arzneimittel.
Das betrifft die Einzelverordnung auf Namen des Patienten und die Verordnung Sprechstundenbedarf.
Das Richtgrößenvolumen bildet somit eine Art Budget (Summe in € für die Verordnung), die für den Hausarzt oder Facharzt für die Verordnung von Arznei und Verbandmitteln pro Patient und Quartal zur Verfügung steht.
E-Learning-Kurse zum Thema Abrechnung mit DRACO WUNDE⁺
Definitionen zur Richtgrößenprüfung
Richtgröße: Als Richtgröße wird der Eurobetrag bezeichnet, der für Arznei- und Verbandmittel (inkl. Sprechstundenbedarf) sowie Heilmittelverordnungen pro Patienten und Quartal im Durchschnitt zur Verfügung steht.
Richtgrößenvolumen: Das Richtgrößenvolumen errechnet sich durch Multiplikation der Fallzahl je Fallgruppe pro Quartal mit den dafür jeweils vereinbarten Richtgrößen und Addition der Summen für das gesamte Jahr.
Richtgrößenprüfung: Der Prüfung wird das gesamte Brutto-Verordnungsvolumen eines Jahres zugrunde gelegt und dem Richtgrößenvolumen gegenübergestellt. Die Richtgrößenprüfung ist eine Jahresprüfung, so dass saisonale Verordnungsschwankungen der einzelnen Quartale ausgeglichen werden können. Die Prüfung erfolgt getrennt für Arznei- und Verbandmittel einschließlich Sprechstundenbedarf einerseits und Heilmittel andererseits.
Richtwertprüfung: In Baden-Württemberg erfolgt die Überprüfung einer wirtschaftlichen Verordnungsweise auf Grundlage einer Richtwertesystematik. Dabei werden Wirkstoffe/Wirkstoffgruppen nach ihrem zugelassenen Anwendungsgebiet zu Arzneimittel-Therapiebereichen (AT) zusammengefasst. Wirkstoffe, die zur Behandlung schwerwiegender oder seltener Erkrankungen angewendet werden, sind häufig auch bei einem indikationsgerechten Einsatz mit hohen Kosten verbunden. Diese Wirkstoffe werden einem externen Richtwerte-Bereich zugeordnet. Ihre Kosten fließen dann nicht in die statistische Richtwertprüfung ein.
Wirkstoffprüfung: Im Fokus stehen hier nicht mehr die Kosten der Arzneimittel oder die Anzahl der Verordnungen in den Arztpraxen, sondern lediglich die Quoten verordneter Generika bzw. Leitsubstanzen in festgelegten Wirkstoffgruppen auf Basis von Tagesdosen (DDD). Die arztbezogene Prüfung von Verordnungen bezieht sich im Wesentlichen auf die Arzneimittelauswahl innerhalb einer Wirkstoffgruppe und die Wirkstoffmengen im jeweiligen Anwendungsgebiet. Für die relevanten Indikationen wurden Zielwerte für die Anteile empfohlener Wirkstoffe in festgelegten Wirkstoffgruppen berechnet. Die empfohlenen Wirkstoffe umfassen: Generika, Leitsubstanzen in den Wirkstoffgruppen ohne generischen Wettbewerb, Rabattarzneimittel.
Durchschnittswertprüfung: Bei der Prüfung nach Durchschnittswerten werden die Verordnungskosten eines Arztes mit den durchschnittlichen Verordnungskosten der Fachgruppe verglichen. Auffällig wird der Arzt nach Abzug der Praxisbesonderheiten bei Überschreitung um mehr als 50% (KV Nordrhein und KV Niedersachsen) oder 45% (KV Hessen) des Fachgruppendurchschnitts. Im Gegensatz zu den Richtwerten werden die Durchschnittswerte erst nach dem jeweiligen Verordnungszeitraum berechnet und können deshalb nicht im Voraus angegeben werden. Das tatsächliche Verordnungsverhalten des Arztes wird somit besser abgebildet.
Zielwertprüfung: Zielwerte sind in unterschiedlicher Form, sei es durch Orientierung an Leitsubstanzen oder durch Verordnungshöchst- oder Mindestquoten, in allen KVen Bestandteil der einzelnen Wirtschaftlichkeitsprüfungen bzw. Arzneimittelvereinbarungen, um eine wirtschaftliche Verordnungsweise der Vertragsärzte zu gewährleisten. Die Einhaltung dieser Ziele kann prüfbefreiend sein – es besteht also ein hoher Anreiz, nach den entsprechenden Zielen zu verordnen.
Prüfung nach Auffälligkeitsgrenzen: Hier werden Abweichungen von vereinbarten Zielwerten geprüft (Vereinbarung von Auffälligkeitsgrenzen). Auffälligkeitsprüfungen erfolgen in der Regel für nicht mehr als 5% der Ärztinnen und Ärzte einer Fach- bzw. Vergleichsgruppe (Vereinbarung von Höchstquoten).
Prüfung nach Referenz-Fallwerten: Hierbei werden Referenzfallwerte auf Basis der Verordnungskosten aus dem Vorvorjahr sowie für das Prüf-Jahr ermittelt und der für den Arzt günstigere Wert verwendet.
Verordnungsvolumen: Die Richtgrößen beziehen sich auf die insgesamt behandelten Patientinnen und Patienten und geben das durchschnittliche Verordnungsvolumen je Fall an. Das jeweilige Richtgrößenvolumen einer Praxis errechnet sich aus den Richtgrößen und den Fallzahlen der Praxis.
Richtwert-Volumen: Dieses findet in Baden-Württemberg Anwendung. Es setzt sich zusammen aus dem Praxisindividuellen Richtwert (PiRW) multipliziert mit der Zahl der Verordnungspatienten plus einem zusätzlichen Puffer von 25 Prozent. Überschreitet eine Praxis ihr Richtwert-Volumen um mehr als den Zusatzpuffer, erfolgt zunächst durch die KV eine unterjährige quartalsweise Neuberechnung der praxisindividuellen Morbidität. So wird eruiert, ob die Überschreitung durch eine höhere Morbidität der Patienten verursacht worden ist. Ein Widerspruchsverfahren kann gegebenenfalls vermieden werden.
Arzneimittelquote: Teil der Prüfvereinbarung – hier werden definierte Anteile an Substanzen für die Verordnung zugrunde gelegt.
Effektive Maßnahmen, um einen Regress zu vermeiden:
- Preisbewusste Verordnung von Arzneimitteln sowie Verbandmitteln
- Lückenlose Wunddokumentation inklusive Fotodokumentation
- Dokumentation von anerkannten Praxisbesonderheiten